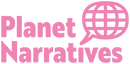"Every crisis is in part a storytelling crisis."
Die Klimakrise ist auch eine Krise der Vorstellungskraft – und Vorstellungskraft ist unser Geschäft.
Planet Narratives ist eine gemeinnützige Initiative, die Filmschaffende dabei unterstützt, die Zukunft des Planeten in ihren Geschichten unterzubringen.
Workshops
Wir organisieren Climate-Fiction-Workshops für Drehbuchautor*innen.
Panels & Diskussionen
Wir veranstalten Podien für Entscheider*innen der Branche im kleinen Kreis mit hochkarätigen Gästen aus Wissenschaft, Aktivismus und den erzählenden Zünften.
Beratung & Recherche
Wir unterstützen Erzählprojekte mit Recherche und Beratung, von der Konzeption bis zum fertigen Drehbuch.
Aktuelles
Warum es neue Erzählungen braucht
Die Klima- und Biodiversitätskrise ist real, sie ist bedrohlich, ihre Auswirkungen sind schon heute unübersehbar, und sie kann nur gemeinsam bewältigt werden.
Das ist die Wirklichkeit – eine Wirklichkeit, die in den Geschichten, die wir als Filmschaffende erzählen, nicht vorkommt. Weder die verheerenden Unwetter, Überschwemmungen, Stürme, Dürre, Waldbrände werden miterzählt, noch zeigen wir die vertrockneten Gärten und die abgestorbenen Wälder. Wichtiger noch: Offenbar teilen die Figuren in den Geschichten die Sorgen nicht, die sich die Menschen außerhalb der Geschichten um die Zukunft machen.
Eine Studie der MaLisa-Stiftung über die Präsenz von Klimawandel und Biodiversität im deutschen Fernsehen stellt fest, dass nur 1,8% der Sendeminuten einen Bezug zum Klimathemen haben, sich aber 62% des Publikums wünschen, dass der Klimawandel häufiger Thema ist.
A Glaring Absence, eine vergleichbare Studie aus den USA, kommt für das dortige Publikum zu ähnlichen Ergebnissen, mit der Schlussfolgerung, dass weite Teile des Publikums ihre Zukunftssorgen nicht in den Charakteren auf der Leinwand wiederfinden.
Diese Weigerung, die bestehende Realität abzubilden, führt zu einer zunehmenden Entfremdung des Films und des Fernsehens von der Lebenswelt des Publikums. Das nimmt unseren Geschichten viel Kraft.
Das Klima miterzählen liegt also im künstlerischen und im wirtschaftlichen Interesse einer Industrie, die darauf angewiesen ist, ihre Zielgruppe mit authentischen, nahbaren Figuren und Narrativen zu erreichen.
Aber nicht nur das: Es liegt auch in unserer Verantwortung als Geschichtenerzähler, die Macht und Reichweite guter, fesselnder, relevanter Erzählungen einzusetzen, um unseren Beitrag zur Transformation zu leisten. Denn der Film als Medium hat eine große gesellschaftliche Wirkmacht. Er kann mit den Bildern, die er produziert, besser als jeder Faktenbericht Dinge vorstellbar und fühlbar machen, für die den Menschen bisher die Vorstellungskraft fehlt – Vorstellungskraft, die wir bitter nötig haben.
Indem wir Lösungen ins Spiel bringen und positive Szenarien erzählen, indem wir das „Wofür“ statt das „Wogegen“ aufzeigen, indem wir Sehnsuchts- statt Angstgeschichten erschaffen, können wir den Zuschauer aus der gefühlten individuellen Hilflosigkeit, die uns hemmt, herausführen in die kollektive Selbstwirksamkeit.
Diese Superpower, die wir als Filmschaffende haben, nämlich eine wirksame Geschichte zu erzählen, die viele Menschen erreicht und berührt, ist eine der größten Kräfte, die wir im Kampf gegen den Verlust unserer Lebensgrundlagen mobilisieren können.
Team
Nicole Zabel-Wasmuth ist Medien- und Umweltrechtlerin mit jahrelanger Erfahrung in der Filmbranche. Lars Jessen ist vielfach preisgekrönter Regisseur und Produzent. Beide teilen die Leidenschaft für gute Geschichten – und die Irritation darüber, dass in den Stories, die wir erzählen, Zukunftsnarrative kaum eine Rolle spielen.
Mit Planet Narratives und einem großartigen Netzwerk aus Expertinnen und Experten aus Film, Fernsehen, Klimawissenschaft, Klimapsychologie und Klimakommunikaton wollen sie diese Situation ändern und das gewaltige Potential der erzählenden Zünfte für mitreißende Zukunftserzählungen realisieren helfen.

Nicole Zabel-Wasmuth

Lars Jessen
"Kaum etwas kann uns so tiefgreifend verändern wie eine gut erzählte Geschichte."
Netzwerk
Planet Narratives ist Teil der gemeinnützigen Initiative Mission Wertvoll.
In der Entwicklung unserer Inhalte und der Durchführung unserer Veranstaltungen arbeiten wir eng mit einigen der renommiertesten Expertinnen und Experten auf den Gebieten der Klima- und Transformationsforschung, der Klimakommunikation – und psychologie und des Geschichtenerzählens zusammen.
Prof. Stefan Rahmstorf ist Klimawissenschaftler, einer der Leitautoren des vierten IPCC-Berichts und einer der weltweit meistzitierten Forscher seines Fachgebiets.
Prof. Maja Göpel ist Politökonomin, Transformationswissenschaftlerin, Autorin und Gründerin/Geschäftsführerin von Mission Wertvoll
Prof. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Nachhaltige Transformation an der FH Münster und leitet dort den neuen Masterstudiengang Nachhaltige Transformationsgestaltung. Urner gründete 2016 das erste werbefreie Online-Magazin “Perspective Daily” für konstruktiven Journalismus mit und ist seit 2020 Kolumnistin bei der Frankfurter Rundschau. Ihre Bücher “Schluss mit dem täglichen Weltuntergang”, “Raus aus der ewigen Dauerkrise” und “Radikal emotional” sind Spiegel-Bestseller.
Samira El Ouassil ist Schauspielerin, Musikerin und Autorin (u.a. Übermedien und Spiegel). Mit Friedemann Karig schrieb sie Erzählende Affen – ein Buch über die ambivalente Wirkungsmacht von Geschichten und darüber, welche Erzählungen uns heute gefährden und warum wir neue benötigen.
Katharina van Bronswijk ist als Sprecherin der Psychologists and Psychotherapists for Future Expertin für die komplexen Zusammenhängen zwischen Umweltkrisen und psychischer Gesundheit, zu denen sie regelmäßig Vorträge hält, Interviews gibt und publiziert (zuletzt Climate Action – Psychologie der Klimakrise; Klima im Kopf).
Silke Zertz hat über 40 Spielfilme und Mehrteiler für das deutsche Fernsehen geschrieben und für ihre Arbeit sowohl den Deutschen als auch den Bayerischen Fernsehpreis bekommen. Sie setzt sich in Theorie und Praxis dafür ein, die Kraft populärkultureller Narrative in der Klimakrise zu erkennen und zu nutzen.
Dr. Insa Thiele-Eich ist Meteorologin, wissenschaftliche Koordinatorin am Meteorologischen Institut der Universität Bonn und Kandidatin für die erste deutsche Astronautin.
Moritz Vierboom ist Schauspieler und Mitgründer der Initiative Changemakers.film, die in den letzten Jahren wesentliche Beiträge zur Nachhaltigkeit in der Filmbranche geleistet hat, etwa für die Entwicklung und größere Sichtbarkeit ökologischer Standards für Dreharbeiten.
"What we cannot imagine, cannot come into being."
Newsletter
Wir versenden in loser Folge drei bis vier Newsletter pro Jahr, mit Filmbesprechungen aus unserer spezifischen Perspektive auf die transformatorische Kraft von Geschichten, mit Veranstaltungsankündigungen und Neuigkeiten aus unserem Netzwerk. Melde dich gern hier an, um mitzulesen!
Erzähl uns was
Unterstützen Sie uns mit einer Spende
Unterstützen Sie uns mit einer Spende
Wenn du an die Kraft des Erzählens glaubst und dabei helfen möchtest, große Geschichten mit großer Wirkung in die Welt zu bringen, dann unterstütze Planet Narratives mit einer Spende!
Jeder Beitrag zählt. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Storytellings.
Spende als Überweisung
Gerne können Sie Ihre Spende auch auf das folgende Bankkonto überweisen:
Kontoinhaber: Global Eco Transition gGmbH
Verwendungszweck: Spende „Planet Narratives“
Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE62 4306 0967 1230 6808 00
BIC: GENODEM1GLS
Spendenquittung: Gern stellen wir Ihnen für Ihre Spende eine steuerabzugsfähige Spendenquittung aus. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck Ihrer Überweisung auch Ihre Postanschrift an.